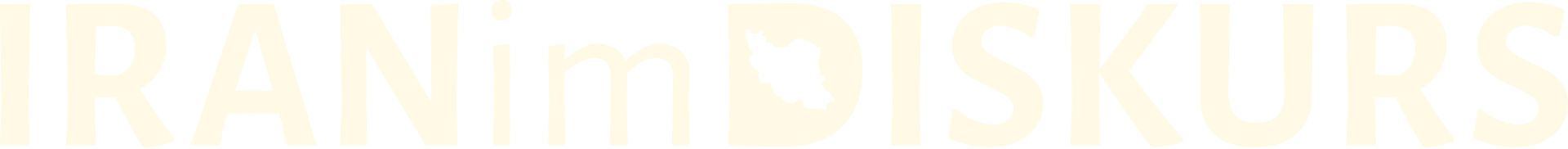Eine Analyse post-islamischer Republik-Szenarien für ein säkulares Iran
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die theologische Verankerung der reformistischen Führung
- 2. Der intellektuelle Einfluss bleibt islamisch geprägt, der Islamische Revolution treu und gegen säkulare Kräfte gerichtet
- 3. Reformisten als künftiges trojanisches Pferd in einem säkularen Iran
- 4. Die Strategie der Reformisten zielt stets auf den Erhalt des klerikalen Regimes ab
- 5. Dauerhafte antiwestliche und antiisraelische Ideologie
- 6. Schwächung der moralischen Integrität Europas, versäumte Allianzen und Beitrag zur politischen Stagnation
- 7. Eine wiederholte Falle: westliche Komplizenschaft und die verdeckte islamistische Bedrohung
- Politische Handlungsempfehlungen
- Die Dichotomie zwischen Reformern und Hardlinern hinter sich lassen
- Einen klaren demokratischen Maßstab für den Umgang mit Reformern festlegen
- In Irans säkulare Opposition investieren
- Jegliche Rechtfertigung des islamistischen Reformismus konsequent zurückweisen
- Einen langfristig orientierten, prinzipientreuen Rahmen schaffen, der auf festen Grundsätzen statt auf kurzfristiger Opportunität basiert
Transitorische Kräfte oder Komplizen des islamischen Regimes? Warum Irans Reformisten riskante Partner für ein zukünftiges demokratisches Iran sind
Einleitung:
Die Islamische Republik durchlebt gegenwärtig eine beispiellose Phase innerer Unzufriedenheit. Seit 2017 kommt es nahezu jährlich zu bedeutenden regierungsfeindlichen Protesten. Eine auffällige Verdichtung im Vergleich zu früheren Dekaden, in denen zwischen größeren Aufständen etwa zehn Jahre lagen. Diese Proteste zeichnen sich durch zunehmende Intensität, längere Dauer und verkürzte Abstände aus. Zugleich gerät das Regime außenpolitisch unter Druck. Seine Stellvertreterkräfte verlieren an Einfluss, die Lage seiner Verbündeten in Syrien, im Libanon und im Irak verschlechtert sich, zentrale Figuren wie Ismail Haniyeh (Hamas) und Seyed Hassan Nasrallah (Hisbollah) geraten ins Wanken. Die Gefahr eines Angriffs auf seine Nuklearanlagen verschärft die Notlage der Islamischen Republik zusätzlich.
Hinzu kommt eine massiv geschwächte Wirtschaft. Die Landeswährung hat seit 2018 mehr als das Zehnfache ihres Wertes verloren und befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Das Regime steht somit vor einer vielschichtigen, existenziellen Krise. Immer mehr iranische Aktivistinnen und Aktivisten sowie öffentliche Persönlichkeiten, selbst solche mit Nähe zum Machtapparat, sprechen offen von einem drohenden Kollaps und fordern eine Kursänderung. In der Konsequenz könnte die Islamische Republik schon bald tiefgreifende Umwälzungen erleben, die selbst erfahrene Beobachter überraschen würden. Zahlreiche Iraner, darunter auch Personen aus dem innersten Kreis um den Obersten Führer Seyyed Ali Khamenei, sagen offen: „Das Regime ist dem Untergang geweiht.“ Einige von ihnen prognostizieren das Ende sogar innerhalb der nächsten fünf Jahre oder früher.
Mitten in der größten Krise seit der Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979 griff Irans Oberster Führer erneut zu seiner Strategie des „guten Polizisten, bösen Polizisten“ – dieses Mal, indem er einen sogenannten „guten Polizisten“ als Kandidaten für das Präsidentenamt im vergangenen Jahr aufstellte. Trotz massenhafter Disqualifizierungen reformistischer Kandidaten und Wahlmanipulationen, wie bereits bei der Wahl 2009, die zu landesweiten Protesten führte, entschied sich Ali Khamenei, der absolute Kontrolle über die Auswahl und Zulassung der Kandidaten besitzt, dazu, einem reformistischen Kandidaten den Sieg bei der von oben gesteuerten Präsidentschaftswahl 2024 zu ermöglichen. Obwohl zahlreiche reformistische und nicht-reformistische Bewerber ausgeschlossen wurden, wählte Khamenei persönlich den sogenannten Reformisten Masoud Pezeshkian aus und ließ ihn eine Wahl gewinnen, bei der die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte des Landes verzeichnet wurde.
Der inszenierte Wahlsieg von Pezeshkian hat erneut die altbekannte Dichotomie „Reformisten“ gegen „Hardlinern“ hervorgebracht. Diese Narrative dient der Islamischen Republik seit jeher dazu, inneren Unmut zu kanalisieren und zugleich internationale Beobachter zu täuschen. Auch diesmal greifen westliche Medien, politische Analysten und Regierungen diese Inszenierung bereitwillig auf und deuten sie vorschnell als Signal für Mäßigung oder Wandel. Sie unterliegen damit abermals den altbekannten Täuschungsstrategien des Regimes. Parallel dazu inszenieren sich die Reformisten zunehmend als transitorische Kräfte. Als vermeintliche Vermittler eines allmählichen Wandels, die eine umfassende Revolution und den damit verbundenen Umbruch vermeiden und so einem politischen Vakuum oder gar einer Phase der Anarchie vorbeugen könnten.
In diesem Artikel argumentiere ich, dass Irans sogennante Reformisten trotz ihrer gemäßigten Rhetorik keine verlässlichen Verbündeten für die Errichtung eines zukünftigen demokratischen und säkularen Iran darstellen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie über insgesamt mehr als 16 Jahre hinweg die Präsidentschaft der Islamischen Republik innehatten, ohne jemals auch nur annähernd die von ihnen versprochenen Reformziele zu verwirklichen, zeige ich auf, dass sie ideologisch weiterhin tief in den Gründungsprinzipien der Islamischen Republik verwurzelt sind und langfristige Risiken für liberale, demokratische Normen darstellen.
Ich vertrete die These, dass es an der Zeit ist, unsere fortbestehenden Illusionen über Irans sogenannte Reformisten endgültig hinter uns zulassen. Sie sind keine Träger demokratischer Kräfte, sondern Apologeten einer Theokratie in neuem Gewand. Um darzulegen, weshalb Reformisten nicht nur eine strategische Sackgasse, sondern ein potenzielles Risiko für jeden künftigen demokratischen Übergang darstellen, führe ich sieben zentrale Gründe an, die die ideologischen, institutionellen und geopolitischen Gefahren aufzeigen, welche sie für einen zukünftigen säkularen und demokratischen Iran mit sich bringen. Der Artikel schließt mit konkreten politischen Handlungsempfehlungen, um die Wiederholung vergangener Fehler bei der Identifikation tatsächlich demokratischer und säkularer Kräfte im Nahen Osten zu vermeiden.
1. Die theologische Verankerung der reformistischen Führung
Zahlreiche zentrale Persönlichkeiten der Reformbewegung sind Kleriker oder Schüler mit direkter Verbindung zum inneren Zirkel Ayatollah Khomeinis. Zu den prominenten Figuren zählen der ehemalige Präsident Mohammad Khatami, der frühere Präsident des Parlaments der Islamischen Republik sowie der führende reformistische Geistliche Mohammad Mousavi Khoeiniha (Generalsekretär der reformistischen „Vereinigung kämpfender Geistlicher“), Seyed Hadi Khamenei (Bruder des Obersten Führers und bekennender Reformist) sowie zahlreiche weitere Akteure. Nicht nur haben diese Reformisten niemals Khomeinis Erbe – einschließlich seiner Rolle bei Massenhinrichtungen, Repression, dem Export der Revolution und seinem Hass auf Israel – in Frage gestellt, sie haben vielmehr wiederholt ihre Unterstützung für das islamische Regime und dessen „antizionistische“ Haltung bekräftigt, indem sie forderten, die Welt müsse sich zur Vernichtung des Staates Israel mobilisieren.
Man könnte argumentieren, dass solch kompromisslose Stellungnahmen lediglich politischer Opportunität geschuldet seien. Doch dieses Argument erweist sich aus zwei zentralen Gründen als nicht tragfähig.
Erstens ließe sich politische Zweckmäßigkeit allenfalls durch Schweigen oder Zurückhaltung erklären, nicht jedoch durch die aktive Verbreitung ideologischer Parolen des Regimes – wie etwa die Verherrlichung Khomeinis, die Verteidigung der Gründungsmythen der Islamischen Republik oder die offensiv artikulierte Delegitimierung Israels. Dass nahezu sämtliche führenden reformistischen Akteure diese Positionen öffentlich vertreten, legt den Schluss nahe, dass es sich nicht um bloße rhetorische Manöver handelt, sondern um eine bewusste Bekräftigung der zentralen Glaubenssätze des Regimes. Wäre ihr Handeln allein vom politischen Überlebenswillen motiviert, müssten wir ein deutlich pragmatischeres Verhalten beobachten. Stattdessen sehen wir eine fortwährende Ausrichtung auf ideologische Kernprinzipien: die Feindschaft gegenüber Israel und dem Westen, die ungebrochene Verehrung Khomeinis sowie die konsequente Verteidigung der Islamischen Republik als System. All dies lässt keinen Zweifel daran, dass Reformisten nicht unter Zwang handeln, sondern aus Überzeugung – und dass sie keineswegs bereit sind, sich von den ideologischen Fundamenten der Islamischen Republik zu lösen.
2. Der intellektuelle Einfluss bleibt islamisch geprägt, der Islamische Revolution treu und gegen säkulare Kräfte gerichtet
Nicht nur die politischen Akteure der Reformbewegung leisten Widerstand gegen einen säkularen Iran, der die gesellschaftspolitische Ordnung über den Islam und Khomeini hinaus neu definieren möchte – auch Intellektuelle und Akademiker wie Abdolkarim Soroush, Sadegh Zibakalam und weitere, die unter den Reformisten erheblichen Einfluss genießen, halten im Kern an der schiitisch-islamischen Weltanschauung und den Grundsätzen der Islamischen Republik fest. Zwar betonen sie häufig ihre vermeintliche Kompatibilität mit säkularer Demokratie, doch in Wahrheit propagieren sie eine sogenannte „religiöse Moderne“, deren Ziel es ist, schiitisch-islamische Werte fest im öffentlichen Leben zu verankern.
Im Falle eines Irans nach dem Sturz der Islamischen Republik wäre zu erwarten, dass diese Akteure politische Parteien und Institutionen etablieren würden, die unter dem Deckmantel demokratischer Legitimität eine sanfte, wenn auch subtile Theokratie fördern. Besonders exemplarisch ist Sadegh Zibakalam, Träger des Freedom of Speech Award der Deutschen Welle, Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Teheran und offenkundiger Kritiker der Islamischen Republik, der trotz seiner Haftstrafe durch das Regime öffentlich erklärte, er sei bereit, für die Islamische Republik zu den Waffen zu greifen.

Wenn selbst diese vermeintlich moderaten Intellektuellen, die im Westen insbesondere in Deutschland als Dissidenten gefeiert werden, eine derart kompromisslose Loyalität zum islamischen Regime demonstrieren, zeigt sich unmissverständlich, dass iranische Reformisten kein Vehikel für den Übergang zu einer säkularen Demokratie darstellen. Vielmehr repräsentieren sie eine rhetorisch geschliffene, aber im Kern verschleierte Variante jener Kräfte, die den Säkularismus entschieden ablehnen. Die westliche Unterstützung dieser Persönlichkeiten ist demnach weniger eine Kooperation mit demokratischen und säkularen Bewegungen, sondern vielmehr eine gefährliche Legitimation der fortgesetzten Machtausübung der Islamischen Republik in einer neuen, kaum erkennbaren Form.
Diese sogenannten reformistischen Intellektuellen eint zudem ein gemeinsames Narrativ der Feindseligkeit gegenüber bewährten säkularen Kräften, allen voran Kronprinz Reza Pahlavi. Abdolkarim Soroush, obwohl im Iran selbst zensiert, ließ seine scharfen Angriffe auf die Pahlavis ungehindert im Internet verbreiten und bezeichnete Reza Pahlavi als weltfremd angesichts des tief religiösen Gefüges der iranischen Gesellschaft. Diese polemischen Angriffe entlarven den aktiven Widerstand reformistischer Denker gegen die säkulare Vision, welche die Islamische Republik ablösen könnte. Tragisch ist, dass diese Figuren im Westen als mutige Dissidenten wahrgenommen werden, während sie durch die subtile Unterwanderung populärer säkularer Bewegungen faktisch die Islamische Republik weiter stärken. Dies stellt eine eindringliche Warnung an den Westen dar: Das Ziel der Reformisten ist nicht die Beendigung der Theokratie, sondern deren Fortbestand in einem neuen Gewand, das umso tückischer ist, weil es schwerer zu durchschauen ist.
3. Reformisten als künftiges trojanisches Pferd in einem säkularen Iran
Angesichts des beispiellosen Ausmaßes öffentlicher Unzufriedenheit, die aus den katastrophalen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen und der repressiven Politik des Regimes resultiert, ist es nicht schwer sich vorzustellen, dass Hardliner im Zuge eines echten demokratischen Übergangs – sei es durch Gewalt oder durch Wahlen – aus der Macht entfernt werden. Genau an diesem Punkt könnten die Reformisten als Retter auftreten und die religiöse Politik verlängern, indem sie eine ideologisch vergleichbare Zwillingsstruktur des derzeitigen Regimes schaffen. Aufgrund ihrer taktischen Flexibilität und ihrer besseren Beziehungen zum Westen ist es wahrscheinlich, dass sie künftige politische Säuberungen überleben werden – und womöglich als Minderheitspartei im neuen Parlament Fuß fassen. Von dieser Position aus könnten sie sich in das politische System einschleusen und als ein trojanisches Pferd fungieren, das den neuen säkularen Staat von innen heraus unterminiert, indem es zentrale Elemente des alten Regimes und seiner Ideologie bewahrt. Wie ich im letzten Punkt dieses Essays noch im Detail erläutern werde, stellt dies ein höchst realistisches Szenario dar – insbesondere im Hinblick auf die bewährten Taktiken islamistischer Gruppen in der gesamten Nahostregion.
4. Die Strategie der Reformisten zielt stets auf den Erhalt des klerikalen Regimes ab
Die Reformisten Irans verfolgen eine gut erkennbare Strategie, die sich als eine Art „Fürstenspiegel“ charakterisieren lässt. Sie unterbreiten dem Herrscher fortwährend Empfehlungen und appellieren an seine Gerechtigkeit oder Weisheit, um ihn zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Doch diese Appelle entspringen weder einem aufrichtigen Bekenntnis zu Menschenrechten noch dem Wunsch nach einem freien und säkularen Iran. Vielmehr dienen sie dazu, den Herrscher von der Überlegenheit eines reformistischen Kurses zu überzeugen, eines Kurses, der in Wahrheit einzig dem Erhalt und der Stabilisierung des bestehenden Regimes verpflichtet ist.
Die Reformisten setzen Reformen nicht als Mittel eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels ein, sondern als taktische Anpassungen, um die Herrschaft der Kleriker langfristig zu sichern. Sollte das Regime fallen, ist keineswegs garantiert, dass die Reformisten eine neue säkulare Ordnung akzeptieren würden. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie eine neue religiöse Führungspersönlichkeit um sich scharen, die sie als reformiert anerkennen, und diese darin bestärken, Macht zu konsolidieren, um so ihren eigenen Einfluss innerhalb einer neuen, vermeintlich reformierten religiösen Elite zu erhalten.
5. Dauerhafte antiwestliche und antiisraelische Ideologie
Selbst „gemäßigte“ Reformisten zeigen eine anhaltende Feindseligkeit gegenüber Israel und hegen tiefe Skepsis gegenüber einer Annäherung an westliche Staaten. Antizionismus und Antiwestlichkeit sind ideologische Konstanten – keine bloßen diplomatischen Floskeln. Masoud Pezeshkian betonte erst kürzlich, dass „China und Russland uns in schwierigen Zeiten stets beigestanden haben“, während er die USA und Europa scharf dafür kritisierte, „Hunderte Milliarden Dollar an Schaden“ verursacht und „unermessliches Leid, Tod und Zerstörung über das iranische Volk“ gebracht zu haben. In einer weiteren Rede erklärte Pezeshkian: „So Gott will, werden wir versuchen, freundschaftliche Beziehungen zu allen Ländern außer Israel zu pflegen.“
Die reformistische Weltanschauung gegenüber Israel ist derart feindselig, dass die Grenze zu den Hardlinern nahezu verschwimmt. Eine einfache Internetsuche zu den Ansichten reformistischer Akteure über Israel offenbart ein bislang beispielloses Maß an Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Staat. Erst kürzlich erklärte Mohammad Taghi Fazel Meybodi, Leiter einer reformistischen Geistlichengruppe, kein Mitglied seiner Organisation erkenne „die zionistische Besatzungsmacht an – ein britisches Konstrukt.“ Man muss sich vergegenwärtigen, dass Meybodi in der Vergangenheit wegen seiner Ansichten zu Frauen vor islamische Gerichte geladen wurde, aber dennoch eine unnachgiebige Haltung gegenüber Israel beibehält – was zeigt, wie sehr selbst reformistische Akteure zentrale ideologische Grundsätze der Islamischen Republik verinnerlicht haben, selbst wenn sie sich in theologischen Fragen mit den Hardlinern überwerfen.
6. Schwächung der moralischen Integrität Europas, versäumte Allianzen und Beitrag zur politischen Stagnation
Je mehr Europa auf einen Dialog mit reformistischen Kräften innerhalb des Regimes besteht, desto weniger Raum bleibt für den Aufbau tragfähiger Beziehungen zu den tatsächlich säkularen Kräften – nämlich der Opposition im Exil, säkularen Intellektuellen, Frauenrechtsaktivistinnen und jugendgeführten Bewegungen, die innerhalb wie außerhalb Irans an Einfluss gewinnen. Vor allem jedoch stellt eine Partnerschaft mit Kronprinz Reza Pahlavi die sicherste Option für Europa dar: ein unter Iranerinnen und Iranern im Land beliebter Anführer, der nachweislich für säkulare, demokratische Werte eintritt.
Deutschland und die Europäische Union sollten mit äußerster Vorsicht vermeiden, in die trügerische Dichotomie zwischen Hardlinern und Reformisten zu verfallen, ein Narrativ, das die gegenwärtige politische Realität Irans längst nicht mehr treffend abbildet. Wenn Europa an dieser veralteten binären Sichtweise festhält, verpasst es nicht nur die Chance, mit den tatsächlichen säkularen Kräften Irans in Kontakt zu treten, sondern behindert diese Beziehungen aktiv, indem es Zeit und Ressourcen auf die Reformisten fokussiert.
7. Eine wiederholte Falle: westliche Komplizenschaft und die verdeckte islamistische Bedrohung
Ein oft übersehener, aber entscheidender Grund zur Vorsicht im Umgang mit iranischen Reformisten ergibt sich aus regionalen Erfahrungen mit sogenannten „moderaten Islamisten“. Von den Übergangsprozessen nach dem Arabischen Frühling in Ägypten über die Muslimbruderschaft bis hin zur langjährigen Herrschaft der AKP in der Türkei – westliche Entscheidungsträger haben wiederholt die langfristigen Gefahren unterschätzt, die von „moderaten“ islamistischen Akteuren in der Region ausgehen. Auch wenn diese „Moderaten“ zunächst nicht offen militant oder feindselig auftreten wie etwa der IS oder die Hardliner der Islamischen Republik, verfolgen sie letztlich ideologisch getriebene Programme, die grundlegende liberaldemokratische Werte wie Säkularismus, Meinungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit und Minderheitenrechte herausfordern.
Iranische Reformisten zeigen ähnliche Muster – und könnten im Fall eines Machtgewinns diese sogar noch deutlicher ausprägen. Ganz wie die Muslimbruderschaft (al-Ikhwan al-Muslimun) in Ägypten oder die AKP unter Erdoğan in der Türkei geben sich iranische Reformisten dem Volk und den demokratischen Werten verpflichtet, streben jedoch im Kern eine politische Umgestaltung entlang islamischer Linien an. Zwar ist ihre Rhetorik kultivierter und ihre Taktik pragmatischer als die ihrer radikalen Gegenparts, doch ihr letztendliches Ziel steht im Widerspruch zu den Grundprinzipien offener, säkularer und pluralistischer Gesellschaften. In diesem Sinne stellen sie auf lange Sicht eine ernstere Bedrohung für ein säkulares Iran dar als offen extremistische Kräfte, weil sie vom Westen Unterstützung – oder zumindest Neutralität – genießen, während sie aus dem Inneren heraus gegen westliche Werte agieren.
Die Unterstützung solcher Gruppen wäre ein strategischer Fehler. Wir sollten uns fragen: Warum sollten westliche Demokratien sich mit Akteuren verbünden, die ihre Legitimität innerhalb Irans längst verloren haben, die Gewalt gegen Bürger, gegen den Staat Israel und mitunter sogar gegen westliche Interessen ermöglicht oder gerechtfertigt haben?
Politische Handlungsempfehlungen
Die Dichotomie zwischen Reformern und Hardlinern hinter sich lassen
Westliche Regierungen – insbesondere Deutschland und die EU – sollten sich von dem überholten Konzept verabschieden, Irans politisches System als echten Wettstreit zwischen Reformisten und Hardlinern zu betrachten. Diese Dichotomie ist nicht nur innerhalb Irans obsolet geworden, sondern verhindert auch ein klares Erkennen der ideologischen Einheitsfront des Regimes, das sich durch Opposition gegenüber Säkularismus, Feindseligkeit gegenüber Israel, den USA und dem Westen sowie der Aufrechterhaltung klerikaler Herrschaft definiert.
Einen klaren demokratischen Maßstab für den Umgang mit Reformern festlegen
Jede Einzelperson oder Gruppierung, die politische Unterstützung oder Engagement des Westens anstrebt, muss klaren, nicht verhandelbaren Kriterien genügen: eine öffentlich erklärte Verpflichtung zu einem säkularen Iran, eine unmissverständliche Ablehnung von Khomeinis Vermächtnis, eine eindeutige Zurückweisung anti-israelischer Rhetorik und Offenheit zur Zusammenarbeit mit demokratischen Staaten. Die Zeit, in der jeder, der das Wort „Reform“ benutzt, automatisch Glaubwürdigkeit erlangt, muss in Europa enden.
In Irans säkulare Opposition investieren
Europa muss seine politische Aufmerksamkeit und seine Ressourcen gezielt auf die wachsende und populäre säkulare-demokratische Opposition im Iran richten. Zu ihren zentralen Akteuren zählen Kronprinz Reza Pahlavi, führende Frauenrechtlerinnen aus der Basisbewegung, studentische und gewerkschaftliche Aktivistinnen und Aktivisten sowie Exilintellektuelle, die sich für demokratische, säkulare und inklusive Regierungsformen einsetzen. Viele von ihnen genießen seit Jahren breite gesellschaftliche Legitimität unter Iranerinnen und Iranern und vertreten Werte, die mit Europas strategischen und ethischen Interessen im Einklang stehen.
Jegliche Rechtfertigung des islamistischen Reformismus konsequent zurückweisen
Statt sich vorschnell mit den am leichtesten erreichbaren Akteuren innerhalb Irans einzulassen, sollten westliche Regierungen langfristig einen prinzipiengeleiteten Rahmen entwickeln und strategische Beziehungen zu säkularen, menschenrechtsorientierten Kräften aufbauen. Dieses Vorgehen mag größeren Aufwand erfordern, doch der Gewinn an Stabilität, politischen Fortschritten und moralischer Glaubwürdigkeit übertrifft den kurzfristigen Komfort, der sich aus der Zusammenarbeit mit etablierten reformistischen Insiderfiguren ergibt.
Einen langfristig orientierten, prinzipientreuen Rahmen schaffen, der auf festen Grundsätzen statt auf kurzfristiger Opportunität basiert
Westliche Politiker müssen sich stets bewusst machen, dass Reformisten keine Verfechter eines demokratischen Übergangs sind, sondern Überlebenskünstler des Regimes mit einem sanfteren Ton, jedoch unverändertem Fundament. Eine wahrhaftige Demokratisierung und eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Europa sind nur möglich durch Kräfte, die sich von der theokratischen Herrschaft lösen.