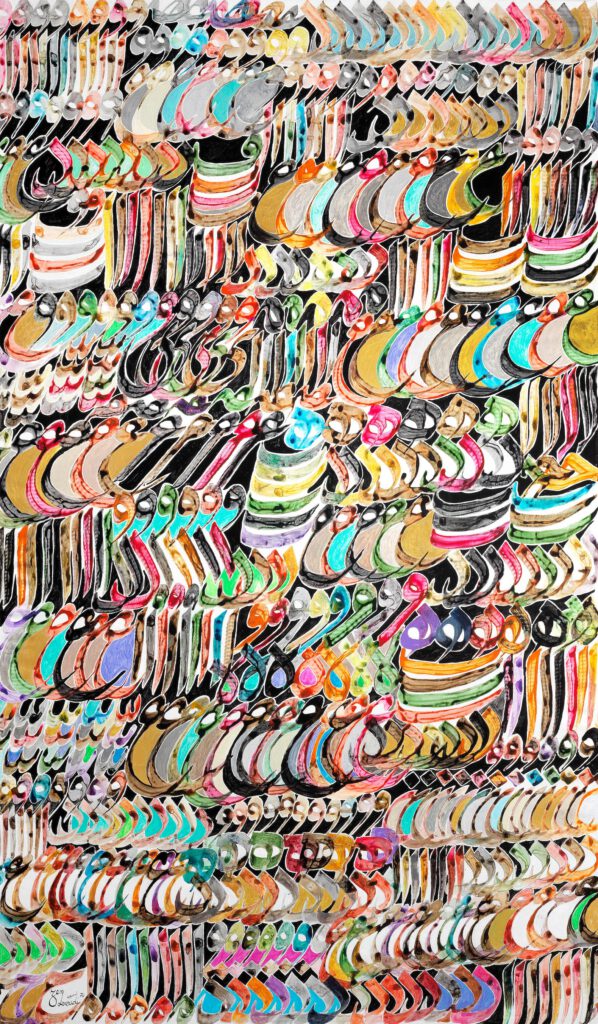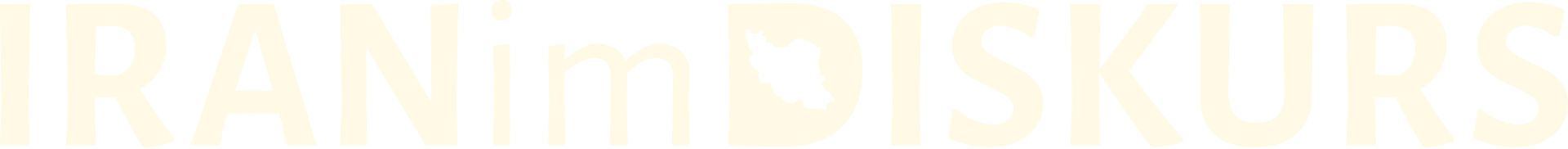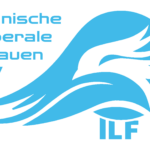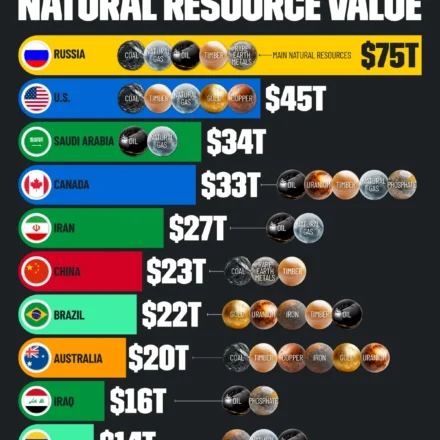Die Idee des Säkularismus – eine iranische Problematik?
Editoral
Der Begriff Säkularismus, dessen Entwicklung ihren Ursprung in Europa hat insbesondere ab dem elften Jahrhundert, formte sich im Kontext tiefgreifender Konflikte zwischen Kirche und Kaisermacht. Im Verlauf des Mittelalters und der Renaissance erhielt diese Idee nach und nach eine theoretische Fundierung und zählt heute zu den fundamentalen Prinzipien staatlicher Ordnung in der modernen Welt. Ursprünglich fokussierte sich der Säkularismus auf die Trennung von religiösem und politischem Bereich im engeren Sinne sowie auf die Begrenzung der absoluten Macht der Kirche. In der Epoche der Aufklärung wurde daraus die institutionelle und philosophische Grundlage moderner Staatlichkeit entwickelt.
Im Iran hingegen hat dieses Konzept weder als Basis institutioneller Ordnung gedient noch blieb es von theoretischen Missverständnissen und politischen Auseinandersetzungen unberührt. Bis heute zählt es zu den kontroversesten und konfliktbeladensten Themen innerhalb der iranischen politischen und intellektuellen Debatte. Betrachtet man den Ursprung des Säkularismus aus historischer Perspektive, so versteht man darunter die Unterscheidung zwischen dem „Religiösen“ und dem „Weltlichen“ im Kontext des Christentums. Einige muslimische Denker vertreten die Auffassung, dass der Islam im Unterschied zum Christentum von Anfang an Regelwerke und Lehren für das „weltliche“ Leben der Gläubigen (der Umma) mitgebracht habe. Aus diesem Grund versuchen manche zu erläutern, der Islam sei seiner Natur nach bereits eine säkulare Religion. Als Beleg für diese These wird die Struktur der Scharia und das islamische Rechtssystem (Fiqh) angeführt, das bis in die kleinsten Aspekte des sozialen Lebens der Gläubigen eingreift. Umstritten ist diese These jedoch aufgrund der grundlegenden Differenz zwischen der historischen Erfahrung der Säkularisierung im christlichen Abendland und der strukturellen Beschaffenheit des Islams, insbesondere in seiner schiitischen Ausprägung. Die rechtswissenschaftliche Tradition (Fiqh) fungiert hier als normatives Gefüge, das in die detailliertesten Bereiche des gesellschaftlichen, juristischen, ökonomischen und politischen Lebens eingreift. Im schiitischen Kontext führt dies nicht zu einer Trennung, sondern vielmehr zu einer notwendigen Koexistenz von Religion und Staat. Denn der Islam ist eine Religion der Scharia, und die Durchsetzung dieser Scharia zählt zu seinen grundlegendsten Prinzipien. Die Scharia wiederum besteht aus Gesetzesnormen, die aus den Versen des Korans, den religiösen Vorschriften sowie aus der Sunna, der prophetischen Tradition, abgeleitet werden. Sie zielen auf die Regelung der Angelegenheiten der Umma sowie des Personenstatuts der Muslime ab, was heute unter dem Begriff „Zivilrecht“ zusammengefasst wird.
Die schiitische Auslegung des Islam hat im Bereich der politischen Theorie und des öffentlichen Rechts historisch weder eine wesentliche Bedeutung erlangt noch kann sie bis heute tragfähige Konzepte vorweisen. Die wenigen vorhandenen Grundprinzipien, die zugleich als Säulen dieses religiösen Zweigs im Islam gelten, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Jegliche Herrschaft während der sogenannten „Großen Verborgenheit“1 (ġaybat-e kubrā) wird als illegitim angesehen und bezeichnet man als „Herrschaft des Unrechts“2 (ḥokumat-e gawr), da die Ausübung politischer Autorität ausschließlich den „Unfehlbaren“ (maʿṣūmīn), den Imamen, vorbehalten sei.
- Mit dem Beginn der „Großen Verborgenheit“ des zwölften Imams, eines Nachfahren des Propheten, ist der direkte Zugang zu einem unfehlbaren Repräsentanten nicht mehr gegeben, wodurch die Errichtung einer legitimen, vom Imam geführten Regierung unmöglich wurde.
- Dennoch wird aus pragmatischer Sicht jede Form von Herrschaft, selbst wenn sie nicht vollständig legitim ist, einem Zustand völliger Anarchie vorgezogen.
- Folglich neigen die Kleriker traditionell dazu, faktisch bestehende Regime zu akzeptieren, auch wenn sie diese nicht als religiös legitim anerkennen.
- So unterstützten die schiitischen Geistlichen während der Konstitutionellen Revolution im Iran von 1905 bis 1911 die Idee einer konstitutionellen Monarchie, obwohl sie diese ebenfalls zur Kategorie der „Herrschaft des Unrechts“ zählten. Dennoch betrachteten sie sie als das geringere Übel im Vergleich zu einem despotischen Regime.
- Bereits zu dieser Zeit räumten sie mangels expliziter islamischer Vorschriften für staatliche Angelegenheiten faktisch das Recht zur Gesetzgebung in jenen Bereichen ein, die das Verhältnis zwischen Staat und Bürger sowie exekutive Hoheitsaufgaben betrafen. Diese Felder sahen sie als eine „Zone außerhalb der Reichweite der Scharia“ (manṭaqat al-firag) an, in der säkulare Normsetzung als zulässig galt, beispielsweise im Bereich der zivilen und militärischen Verwaltung.
Was hingegen blieb, waren die Bereiche des Personenstandsrechts, des Handels sowie des islamischen Strafrechts. Bereits in den ersten Jahren nach dem Sieg der Konstitutionellen Revolution jedoch geriet auch das Handelswesen zunehmend unter den Einfluss rechtlicher Regelwerke westlicher Herkunft, insbesondere aus Belgien, Frankreich und weiteren europäischen Ländern. In der Folge wurden neue Gesetze entworfen, um den Handel, das Bankwesen und andere moderne Sektoren der nationalen Wirtschaft rechtlich zu regulieren. Diese Gesetzesentwürfe verbanden internationale Vorbilder mit gesellschaftlich anerkannten Normen im Land und wurden schließlich durch die Nationale Beratende Versammlung verabschiedet und in Kraft gesetzt. An diesem Punkt lässt sich das Projekt der konstitutionellen Bewegung als der erste ernstzunehmende Versuch einer rechtlichen Säkularisierung im Iran einordnen. Die Erfahrung der Konstitutionellen Revolution kann tatsächlich als ein einzigartiger Wendepunkt in der politischen Tradition Irans betrachtet werden, da in diesem historischen Moment erstmals die Grundlagen für eine institutionelle Trennung zwischen dem religiösen Normenkanon und einem säkularen Gesetzgebungsprozess geschaffen wurden.
In Fragen des Privatrechts und der zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere hinsichtlich der Rechtsstellung und der Rechte von Frauen im Vergleich zu denen der Männer sowie in Angelegenheiten wie Ehe, Scheidung, Erbfolge und der rechtlichen Feststellung des persönlichen Status, verblieben sowohl die Zuständigkeit als auch die Deutungsmacht ausschließlich bei den islamischen Rechtsgelehrten und innerhalb der auf der Scharia basierenden Rechtsordnung. Mit der Einrichtung und dem Fortbestand des Nationalrats (Majles-e Shorā-ye Melli) entwickelten sich gerade diese Bereiche zu einem der zentralen Spannungsfelder zwischen dem säkularen Staatswesen und der religiös-juristischen Ordnung. Um diesen Konflikt zu entschärfen und eine Konfrontation mit den Klerikern in der Gesellschaft vor 120 Jahren – also in der Anfangsphase der Entstehung und Festigung der politischen und rechtlichen Ordnung des konstitutionellen Staates im Iran – zu vermeiden, wurde zweierlei unternommen: Erstens wurde ein allgemeiner Grundsatz in den Ergänzungsartikel zur Verfassung aufgenommen, demzufolge sämtliche Gesetze im Einklang mit dem „Geist des Islams“ stehen müssen. Zweitens wurden fünf hochrangige Rechtsgelehrte (Fuqaha) in den Nationalrat berufen, um die Gesetzgebung auf ihre Übereinstimmung mit ebenjenem religiösen Geist zu überprüfen. Auf diese Weise gelang es den Befürwortern eines säkularen und weltlich-rechtlichen Staatssystems, das Votum der Geistlichkeit zumindest in Teilen abzumildern.
Von noch größerer Bedeutung für die Festigung eines „säkularen“ Rechtsstaates und für die strukturelle Trennung von Religion und Politik war jedoch die Kodifizierung des Zivilrechts. Die Umwandlung religiös-juristischer Prinzipien in ein modernes, säkulares Gesetzeswerk, verbunden mit der gezielten Vernichtung der Protokolle der Gesetzgebungsdebatten, ermöglichte eine zukünftige Rechtsauslegung, die sich auf Vernunft, gesellschaftlichen Konsens und die Anforderungen einer sich wandelnden modernen Gesellschaft stützt. Besonders im Bereich des Schutzes der Rechte von Frauen und Kindern bedeutete dieses Vorgehen eine erhebliche Einschränkung der Einfluss- und Interventionsmöglichkeiten der Kleriker. Der Prozess der Herauslösung von Politik und Recht aus der religiösen Sphäre sowie die allmähliche Zurückdrängung des Einflusses der Geistlichkeit im Iran beruhte auf zwei essenziellen Voraussetzungen. Zunächst erforderte dieser historische Wandel das Vorhandensein eines handlungsfähigen und legitimierten Staatsapparats, der die institutionellen Grundlagen für ein säkulares Rechtssystem schaffen und dessen Aufbau mit politischer Entschlossenheit vorantreiben sollte. Gleichzeitig war eine gebildete und aufgeklärte Schicht von Intellektuellen notwendig, die in der Lage sein sollte, die neuen weltlich orientierten Rechtsnormen gesellschaftlich zu verankern und den geistigen Boden für ihre künftige Akzeptanz zu bereiten. Diese Elite hätte das säkulare Recht als ein gemeinschaftliches und dauerhaftes Kulturgut begründen und schützen müssen.
In den Regierungszeiten von Reza Schah und Mohammad Reza Schah wurden bedeutende rechtliche Reformen auf den Weg gebracht. Neben dem Zivilgesetzbuch ragte insbesondere das Familiengesetz hervor, das sowohl die Rechte und Freiheiten der Frauen als auch die der nichtmuslimischen Bevölkerungsgruppen erheblich stärkte. Bedauerlicherweise stellte sich jedoch ein erheblicher Teil der intellektuellen Elite, insbesondere unter dem Einfluss antidemokratischer und antiwestlicher Ideologien, gegen diese rechtstaatlichen Fortschritte und suchte stattdessen ideologische Allianzen mit dem klerikalen Establishment. Ein weiterer entscheidender Aspekt im Prozess der Säkularisierung und Rationalisierung des politischen und sozialen Systems im Iran war die Neuordnung der Justiz. Während das Rechtssystem vor der konstitutionellen Revolution vollständig unter der Kontrolle der Geistlichkeit stand, erfolgte mit der Gründung eines modernen Justizwesens, der Einführung einer mehrstufigen Gerichtsbarkeit sowie der Errichtung öffentlicher Registerämter und Notariate eine tiefgreifende Entmachtung der religiösen Autoritäten. Die Geistlichkeit wurde dadurch schrittweise aus der Zuständigkeit für Familienrecht und Strafrecht entbunden, Bereiche, die zuvor unter ihrer alleinigen Kontrolle standen. Dieses Beispiel markiert eine strukturelle Form der Säkularisierung, die durch die Autorität des Staates und die Notwendigkeit einer funktionalen, rationalen Verwaltung motiviert war.
In einer solchen Struktur hat sich das, was in Europa über Jahrhunderte hinweg durch Konflikte, Revolutionen und Philosophie errungen wurde – nämlich die Unabhängigkeit des Staates von der Religion – im Iran, mit Ausnahme einer kurzen Phase während der Pahlavi-Ära, nie dauerhaft durchgesetzt. Aus diesem Grund ist das, was theoretisch unter dem Begriff eines „säkularen Islams“ verhandelt wird, in der Praxis kaum realisierbar. Zur Sicherung des Fortbestands eines säkularen Staates bedarf es einer Institution, die der Autorität der religiösen Sphäre überlegen ist – einer Institution, die in der Lage ist, rechtliche und zivilgesellschaftliche Ordnungen aus der Vormachtstellung des Klerus zu befreien.
In dieser Ausgabe der Zeitschrift versuchen drei Beiträge auf Grundlage historischer, struktureller und theoretischer Analysen das Verhältnis von Islam Staat und Säkularismus im Iran zu klären. Das Editorial kann aus Raumgründen nicht all die Tiefenschichten und Widersprüche dieses komplexen Zusammenhangs entfalten. Es versteht sich daher als Impuls eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer der grundlegendsten Fragen unserer politischen und gesellschaftlichen Gegenwart anzustoßen:
Wie lässt sich unter den Bedingungen einer religiös geprägten Geschichte und einer tief verankerten schariabezogenen Rechtsordnung die Möglichkeit eines säkularen Staates überhaupt denken? Eine Frage, die zweifellos nach Aufklärung im emphatischen Sinne der Aufklärung nach umfassendem Dialog und nach einer unverstellten Konfrontation mit dem eigenen intellektuellen und institutionellen Erbe verlangt.
- Die große Verborgenheit (ġaybat-e kubrā) ist ein zentraler Begriff im schiitischen Islam, insbesondere bei den Zwölfer-Schiiten. Sie bezeichnet die Zeit, in der der zwölfte Imam, Muhammad al-Mahdi, nicht mehr öffentlich sichtbar ist und sich in einer Verborgenheit befindet. ↩︎
- Im schiitischen Islam bezeichnet der Begriff Unfehlbare (maʿṣūmīn) eine kleine Gruppe von Personen, die als frei von Sünde und Irrtum gelten. Dazu zählen der Prophet Muhammad, seine Tochter Fatima sowie die zwölf Imame. Sie werden als durch göttlichen Schutz vor Fehlern im Glauben und in Rechtsfragen bewahrt angesehen. ↩︎