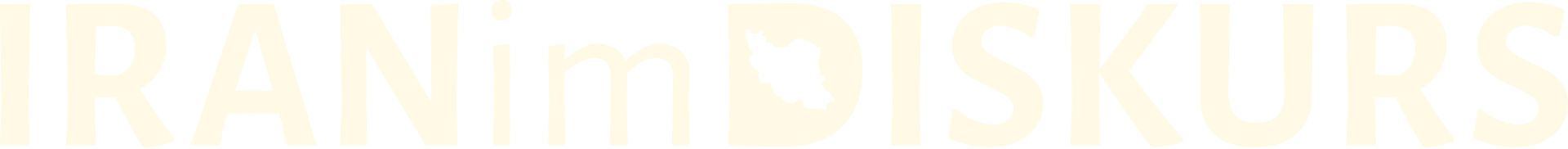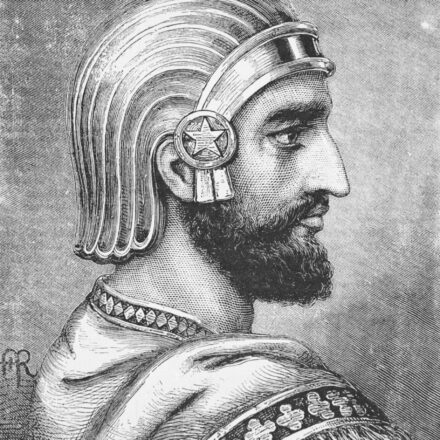Vom Krieg zum Krieg
Inhaltsverzeichnis
- 1980 bis 1988: Der vermeidbare Krieg mit dem Irak
- 2023 bis 2025: Der selbst provozierte Krieg mit Israel
- Ein Land am Abgrund – vor dem Krieg schon in der Krise
- Mögliche zukünftige Entwicklungen
- 1. Verschärfung der inneren Krise
- 2. Eskalation zum regionalen Krieg
- 3. Internationale Isolation
- 4. Kein Wiederaufbau ohne Systemwandel
- 5. Schleichende Systemkrise oder radikale Zäsur
- Fazit
Vom Krieg zum Krieg: Die systemische Selbstzerstörung Irans unter dem Regime
In 46 Jahren hat die Islamische Republik Iran ihr Land in zwei schwerwiegende Kriege geführt – nicht zur Verteidigung, sondern als Folge ideologisch motivierter Außenpolitik und autoritärer Machtlogik. Der erste Krieg gegen den Irak (1980–1988) wurde mutwillig verlängert. Der zweite, aktuell eskalierende Krieg mit Israel ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Konfrontationsstrategie. In beiden Fällen hat das Regime nicht das Land geschützt, sondern es geopfert – zugunsten religiöser Ideologie, panislamischer Ambitionen und machterhaltender Taktik.
1980 bis 1988: Der vermeidbare Krieg mit dem Irak
Nur ein Jahr nach der islamischen Revolution begann der Iran-Irak-Krieg. Teheran hatte zuvor große Teile seiner militärischen Führung durch Säuberungen ausgeschaltet, während Ayatollah Khomeini irakische Schiiten zur Revolte gegen Saddam Hussein aufrief. Der Angriff des Irak war die Konsequenz.
1982 hatte Iran mit der Rückeroberung von Khorramshahr sein ursprüngliches Kriegsziel erreicht. Doch Khomeini verlängerte den Krieg unter dem ideologischen Motto: „Der Weg nach Quds führt über Karbala.“ Das Ergebnis: Hunderttausende Tote, verheerende wirtschaftliche Schäden und die bis heute spürbare Zerstörung der Infrastruktur.
2023 bis 2025: Der selbst provozierte Krieg mit Israel
Auch der gegenwärtige Konflikt ist nicht durch äußere Bedrohung entstanden, sondern durch die aggressive Politik der Islamischen Republik gegenüber Israel. Khomeini bezeichnete Israel als „Krebsgeschwür“, Khamenei wiederholt als „nicht existent in 25 Jahren“. Die langjährige Unterstützung von Hamas, Hisbollah und dem Islamischen Dschihad ist Ausdruck dieser strategischen Feindschaft.
Ein besonders alarmierender Moment war der Raketenabschuss 2016 mit der hebräischen Aufschrift: „Israel muss ausgelöscht werden.“ Diese Provokation fiel in die Phase des Atomabkommens (JCPOA) – ein symbolischer Bruch mit dem Geist diplomatischer Deeskalation.
Nach dem US-Ausstieg aus dem JCPOA 2018 begann Iran mit der beschleunigten Anreicherung von Uran. 2024 meldete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) Werte von über 60 % – technisch nur noch einen Schritt von Waffenfähigkeit entfernt. Israel sah sich existenziell bedroht und berief sich auf die Begin-Doktrin: Präventivschläge gegen Staaten, die Atomwaffen anstreben.
Seit Frühjahr 2024 eskalierte der Konflikt durch wechselseitige Angriffe, Sabotageaktionen und Drohnenangriffe. Im Juni 2025 griff Israel gezielt iranische Nuklear- und IRGC-Stellungen an – worauf Teheran mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff reagierte. Der offene Krieg war damit Realität.

Ein Land am Abgrund – vor dem Krieg schon in der Krise
Bereits vor Kriegsausbruch war der Iran wirtschaftlich und gesellschaftlich destabilisiert. Die Inflation lag laut Weltbank bei über 45 %, die Jugendarbeitslosigkeit überstieg 30 %. Die Versorgungslage ist vielerorts prekär: Stromausfälle, Wassermangel, fehlende Medikamente. Die Protestbewegung „Frau, Leben, Freiheit“ (2022/23) war Ausdruck einer Gesellschaft, die sich vom Regime entfremdet hat. Die Antwort der Machthaber: Repression statt Reform.
Die Bevölkerung trägt nun doppelt – unter innerer Unterdrückung und äußerem Krieg. Die wirtschaftliche Lage verschärft sich, internationale Investoren ziehen sich zurück, und die Revolutionsgarden beanspruchen immer mehr Ressourcen für den Krieg. Das Regime wendet sich gegen die Welt – und gegen das eigene Volk.
Mögliche zukünftige Entwicklungen
1. Verschärfung der inneren Krise
Der Krieg wird die wirtschaftlichen und sozialen Spannungen im Land weiter verschärfen. Die Kombination aus galoppierender Inflation, Ressourcenknappheit, wachsender Repression und politischer Perspektivlosigkeit birgt enormes Protestpotenzial. Besonders gefährlich für das Regime: Über 60 % der Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt – eine frustrierte, digital vernetzte Generation, die Reformen statt Revolutionsrhetorik will.
Eine neue Protestwelle ist wahrscheinlich – möglicherweise nicht mehr nur dezentral und unorganisiert, sondern explosiv und koordiniert.
2. Eskalation zum regionalen Krieg
Falls Iran mit weiteren Raketenangriffen auf Israel oder US-Stützpunkte reagiert, könnten die USA gezwungen sein, militärisch einzugreifen. Gleichzeitig könnte Israel, sollte die IAEA Hinweise auf die Entwicklung nuklearwaffenfähiger Technologie bestätigen, gezielte Großangriffe auf iranische Atomanlagen starten.
Ein solcher Schritt würde nicht nur militärische Ziele, sondern die Infrastruktur des Landes hart treffen – mit Rückwirkungen auf Syrien, Libanon, Irak und den gesamten Persischen Golf. Ein regionaler Flächenbrand wäre kaum noch aufzuhalten.
3. Internationale Isolation
Der Krieg vertieft die diplomatische Isolation Irans. Neue UN- oder EU-Sanktionen wären nahezu sicher. Zwar könnten Russland und China punktuell kooperieren – etwa beim Rohstoffhandel –, jedoch ohne echte strategische Partnerschaft. Beide verfolgen eigene Interessen und sind nicht bereit, sich in Irans Konflikte hineinziehen zu lassen.
Gleichzeitig rücken Israels Beziehungen zu arabischen Staaten wie Saudi-Arabien weiter zusammen – ein geopolitischer Trend, der Teherans Einfluss auf lange Sicht schwächen wird.
4. Kein Wiederaufbau ohne Systemwandel
Solange das islamische Regime in ideologischem Dauerkrieg mit Israel und dem Westen verharrt, bleibt ein wirtschaftlicher Wiederaufbau unmöglich. Internationale Unternehmen meiden das Land, technische Modernisierung bleibt aus. Auch ein Waffenstillstand würde daran wenig ändern – ohne politischen Richtungswechsel gäbe es keine Vertrauensbasis für nachhaltige Entwicklung.
Iran bleibt international ein Risikostandort – wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch.
5. Schleichende Systemkrise oder radikale Zäsur
Mittelfristig sind zwei Szenarien denkbar:
- Schleichender Verfall: Das Regime hält sich durch Repression und Kontrolle, verliert aber zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung. Der Druck wächst, doch der Wandel bleibt langsam und schmerzhaft – mit wachsender innerer Zersetzung.
- Plötzlicher Umbruch: Eine Kombination aus wirtschaftlichem Kollaps, interner Spaltung innerhalb der Machtelite oder ein externer Schock (z. B. gezielter Angriff auf Schlüsselpersonen) könnte einen raschen Umbruch auslösen. Die Protestbewegung könnte in diesem Szenario eine historische Dynamik entfalten.

Fazit
Zwei Kriege in weniger als einem halben Jahrhundert, beide vom Regime selbst herbeigeführt – nicht zur Verteidigung, sondern aus politischer Verblendung. Der Iran hätte sich zu einem regionalen Stabilitätsanker entwickeln können – wirtschaftlich, kulturell, geopolitisch. Stattdessen regiert ein System, das seine Existenz auf Konfrontation, Repression und Isolation stützt.
Die größte Gefahr für den Iran kommt nicht von außen, sondern von innen: von einem Regime, das unfähig ist zur Reform, blind gegenüber der Realität und fest entschlossen, sein ideologisches Projekt selbst um den Preis des nationalen Ruins weiterzutreiben.
Die Geschichte bietet dem Iran – wie schon 1979 – einen Wendepunkt. Ob dieser Wandel von innen kommt oder durch äußeren Druck erzwungen wird, bleibt offen. Doch die Zeit, in der die Islamische Republik zwischen zwei Kriegen überleben konnte, läuft ab.
* Anmerkung der Redaktion:
Dieser Beitrag wurde am 21. Juli 2025 verfasst – noch vor dem direkten militärischen Eingreifen der Vereinigten Staaten in den Konflikt. Entwicklungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht berücksichtigt.