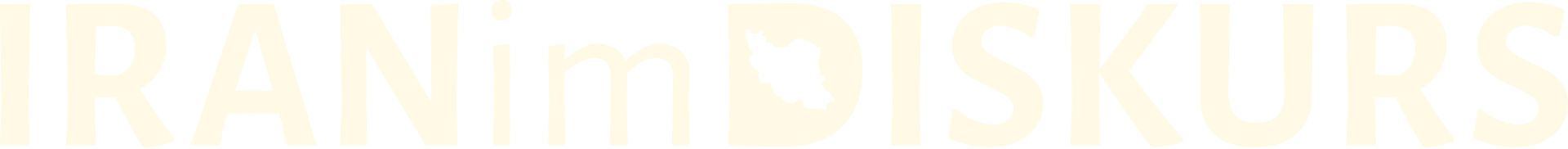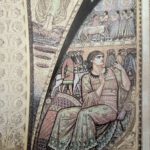Wenn der Iran eines Tages wieder frei wird.
„War der Aufstieg und die Machtübernahme von Reza Khan tatsächlich ein unausweichliches und unvermeidbares Schicksal? Unsere Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Nein. Hätten sich der nationalistisch-liberale Flügel der Aristokratie – repräsentiert durch Persönlichkeiten wie Mostowfi al-Mamalek, Mossadegh al-Saltaneh, Moshir al-Dowleh – sowie oppositionelle Geistliche wie Modarres, die entschlossen waren, die konstitutionelle Monarchie und die Herrschaft von Ahmad Schah zu bewahren, mit dem linken Flügel der oberen und mittleren Schichten zusammengeschlossen, der teilweise in Form der „Nationalen Front“ organisiert war (bestehend aus der Partei der Sozialisten – Amiyoun, unter der Führung von Soleiman Mirza, der unabhängigen Sozialistischen Partei unter Zia al-Vaezin und der Vereinigten Sozialistischen Partei unter Mohammad Sadegh Tabatabai), dazu die progressiven Zeitungen wie „Toofan“ unter der Leitung von Farrokhi Yazdi und „Gharne Bistom“ unter der Leitung von Eshghi, die aufstrebenden Gewerkschaften, die damals an Einfluss und Macht gewonnen hatten, die nicht-offizielle kommunistische Partei Irans und andere ähnliche Kräfte, die sich geschlossen gegen den Aufstieg des neuen Diktators stellten – wenn all diese Kräfte auf einer gemeinsamen Plattform hätten Einigkeit erzielen können, wäre es durchaus möglich gewesen, diesen Aufstieg zu verhindern, ihn in klar definierte Grenzen einzuschränken und seine Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken.
Doch war es tatsächlich möglich, eine solche gemeinsame Plattform zu schaffen? Die Antwort auf diese Frage lautet unmissverständlich: Ja. Die Errichtung eines Regimes, das die Unabhängigkeit Irans vor imperialistischen Übergriffen bewahrt, die Freiheits- und demokratischen Rechte des Volkes schützt und gleichzeitig entschlossen Schritte in Richtung Zentralisierung, Modernisierung, Landreform und Industrialisierung unternimmt, hätte zweifellos die Unterstützung der absoluten Mehrheit der iranischen Gesellschaft gewinnen können.“ („Iran in der Ära von Reza Khan“ – Ehsan Tabari1)
Diese Sätze stammen von Ehsan Tabari, einer der bedeutendsten Theoretiker der Tudeh-Partei (Kommunistische Partei) während der Pahlavi-Ära. In ihnen entwirft er ein alternatives Szenario, das – wäre es damals Realität geworden – die Gründung der Pahlavi-Monarchie hätte verhindern können. In diesem Szenario kommen verschiedene politische Strömungen zusammen, von den Großgrundbesitzern des ehemaligen Regimes unter der Qadscharen-Dynastie bis hin zu den Mitgliedern der damals geheimen Kommunistischen Partei Irans, die sich auf eine „gemeinsame Plattform“einigen. Dieses Szenario blieb zu seiner Zeit zwar unverwirklicht, doch einige Jahrzehnte später wurde es tatsächlich Realität, als 1979 und in den darauffolgenden Jahren eine Vielzahl politischer Kräfte eine „gemeinsame Plattform“ formulierte. Heute können wir mit größerer Klarheit betrachten, worin diese Plattform bestand und welche Elemente sie prägten.
Nach der Revolution von 1979 wurden Nooruddin Kianouri, Generalsekretär der Tudeh-Partei, zusammen mit anderen führenden Mitgliedern, darunter auch Tabari, verhaftet. Diese erfahrenen politischen Akteure, die zu den ältesten Wegbereitern der iranischen Politik zählten, waren überzeugt, dass eine Übereinkunft über grundlegende politische Prinzipien – die sich in Begriffe wie Antimperialismus, Unabhängigkeit Irans und Demokratie fassen ließen – ausreichen würde, um eine Teilhabe an der Macht mit den islamischen Kräften zu ermöglichen. Doch diese Einschätzung erwies sich als fataler Irrtum. Keiner von ihnen war erfolgreich, und stattdessen wurden sie als „politische Verbrecher“ gefoltert und gezwungen, unter dem Druck der Haft Geständnisse gegen sich selbst abzulegen.
Doch eine zentrale Frage bleibt bis heute unbeantwortet: Lässt sich die Vielfalt der politischen Strömungen von 1979 wirklich durch eine einheitliche Logik und eine gemeinsame politische Ausrichtung erklären? Oder handelte es sich vielmehr um widerstreitende Bewegungen, von denen jede darauf aus war, das Machtvakuum nach dem Sturz des Schahs für ihre eigenen Ziele zu nutzen?
Obwohl im zitierten Abschnitt aus Tabaris Werk die „Industralisierung“ Irans thematisiert wird, war es für ihn als Verfechter des Kommunismus und für seine Mitstreiter, die dem iranischen kommunismus nahestanden, vor allem wichtig, die Wirtschaft kollektiv zu gestalten. Unter allen Maßnahmen, die während der Pahlavi-Dynastie umgesetzt wurden, sah er einzig die Landreformen des Schahs als mit den Prinzipien des Sozialismus vereinbar an. Diese Reformen bestätigte er in ihrer Gesamtheit, allerdings mit dem Vorbehalt, dass sie „unzureichend, unvollständig und unzeitgemäß“ waren. Die tatsächliche Bedeutung dieses Vorbehalts liegt darin, dass die Ablehnung der „Liberalisierung“ (Laissez-faire) der Wirtschaft ein gemeinsames Merkmal der damaligen linken Kräfte im Iran und der Islamisten war. Letztere, obwohl sie keine konkrete wirtschaftliche Theorie verfolgten, verteidigten gegen die liberale Wirtschaftspolitik des Schahs eine Art vagen, unklaren Sozialismus. Besonders im linken Flügel der „Islamischen Republik Partei“ war diese Haltung deutlich zu erkennen, einer Partei, deren führende Persönlichkeiten die revolutionären schiitischen Geistlichen waren. Nur der rechte Flügel dieser Partei äußerte sich zögerlich und, wenn überhaupt, mit leichten Einwänden. Dieser Flügel bestand größtenteils aus Vertretern des traditionellen Marktes und war sofort in die Verwaltung und Entscheidungsprozesse des neuen Regimes integriert, unter anderem über Organisationen wie die „Islamischen Motalefeh-Verbände“.
Maziyar Behrooz beschreibt in seinem Buch „Die rebellischen Idealisten2“, wie einige Linke in den Anfangsjahren der Islamischen Revolution dachten, dass die anti-imperialistische Haltung der Islamischen Republik nur eine Übergangsphase sei. Sie gingen davon aus, dass durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen Markt und den schiitischen Geistlichen die Islamische Republik bald eine Annäherung an die Vereinigten Staaten, die als führende Macht des kapitalistischen Systems galten, anstreben würde. Diese Vorhersage erwies sich auch, als völlig falsch. Die traditionellen Geschäftsinhaber im Islamischen Iran nutzten das Monopol auf den Wirtschaftssektor, um minderwertige Produkte zu verkaufen und auf diese Weise Wohlstand anzuhäufen.
Die neue Generation der iranischen Linken hat in ihrer Analyse der scharfen sozialen Ungleichheit, die in der Gesellschaft zu beobachten ist, mitunter behauptet, dass dies die unvermeidliche Folge des globalen „Neoliberalismus“ sei. Doch in Wahrheit hat sich die iranische Wirtschaft nie auf den Weg der Industrialisierung begeben und hat auch niemals die Wirtschaftsliberalisierung erfahren, wie sie vor der Revolution von 1979 umgesetzt wurde.
Der Widerstand gegen die Liberalisierungspolitik wird in den durchweg negativen Assoziationen von „liberal“ und „Liberalismus“ sowie deren Ableitungen (im post-79 Diskurs) deutlich. Wenn wir unseren Blick (über das wirtschaftliche Leben hinaus) auf den kulturellen und sozialen Bereich erweitern, wird ebenso deutlich, dass die Logik einer vollständigen staatlichen Kontrolle in diesen Bereichen von allen politischen Strömungen der 1979er Jahre, sowohl von den Islamisten als auch von der Linken, geteilt wurde und weiterhin geteilt wird.
Die iranischen Linken, die in den administrativen und politischen Strukturen selten eine nennenswerte Rolle spielten, verteidigten bis zum Aufstand um Mahsa Amini sogar das islamische Kopftuch als ein Symbol der Kultur und Identität der breiten Massen.Keiner dieser Linken interpretierte die Politik der Frauenförderung, die sowohl unter der ersten als auch der zweiten Pahlavi-Könige betrieben wurde, als etwas Positives. Diese Politik, die man durchaus als die Befreiung des Körpers der iranischen Frau deuten konnte, wurde von ihnen lediglich als ein Zugang westlicher Luxusgüter für die bourgeoisen oder westlich orientierten Frauen wahrgenommen.
Auch die Anhänger der „verpflichteten Kunst“-Idee zeigten keinerlei Begeisterung für das kommerzielle Kino der Schah-Zeit. Es ist sowohl lehrreich als auch bedauerlich, dass viele der herausragenden Schauspielerinnen und Schauspieler des vorrevolutionären Kinos – ohne jemals politisch für das Regime des Schahs Partei zu ergreifen – es nicht schafften, ihre Karriere fortzusetzen. Die meisten von ihnen taten alles, was nötig war, um „vergeben“ zu werden. Ihre einzige „Sünde“ war es, in einem freien Kino zu arbeiten, das von den schiitischen Geistlichen als „Fessad“ (Sünde) und „Fesq ´o Fujor“ (Verderbtheit und Unzucht) bezeichnet wurde, während die Linken dies als eine Förderung des Liberalismus und der westlichen Kultur verstanden.
Das Kino nach der Revolution war dann von Propaganda, vor allem islamischer Art, durchzogen. Es entstanden zahlreiche historische Serien, die die Geschichte zugunsten der siegreichen Gruppen verzerrten. Diejenigen, die in diesem neuen Genre des Kinos tätig wurden, sehen ihre Zukunft nun gefährdet, da sie sich in einem Klima befinden, das gegen die Traditionen der 1979er Jahre aufbegehrt. Sollte der Iran jedoch eines Tages wieder frei werden und die Politik der Liberalisierung erneut aufgenommen werden, stellt sich die Frage: Könnten die Künstler, die die Idee der „verpflichteten Kunst“ in ihrem Schaffen verwirklicht haben, jemals Vergebung finden? „Die wütenden Menschen, die mit diesem Sprachspiel ihre Ablehnung ausdrücken, verwenden statt des Begriffs ‚Künstler‘ den Ausdruck „Kunstlügner“ und verspotten sie.“
Die grundlegende Logik dessen, was nach dem Sturz des Schahs in der iranischen Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft realisiert wurde, ist am klarsten in den Schriften und Aussagen der iranischen Linken zu erkennen. Sie sind in der Lage, die wahre Natur dessen, was tatsächlich umgesetzt wurde, ohne religiöse Terminologie oder Begriffe aus dem Koran und den Überlieferungen zu benennen. Kurz gesagt, es handelte sich um die Ablehnung der Liberalisierungspolitik.
Diese einheitliche Plattform, die auch heute noch alle Anhänger der Revolution von 1979 miteinander verbindet und trotz der inneren Vielfalt ihrer Vertreter eine gemeinsame Richtung vorgibt, basiert auf der Politik des Laissez-faire.
- احسان طبری، «جامعه ایران در عصر رضاشاه»، انتشارات انجمن دوستداران احسان طبری، (نسخه دیجیتال) صص ۵۵-۵۶ ↩︎
- – “When the revolution was successful, the Marxists were at first puzzled and then titally confused as to the nature of the IRI. To some, like the Tudeh and the Fadaiyan Majority, the fact that the IRI was politically independent and that it (particularly its clerical wing) was often hostile to Western governments, political systems and cultural values, meant that the new state was anti-imperialist and able to pursue a course which might ultimately bring it into the Soviet camp… To others, like the Minority of the Paykar, the absence of any meaningful change in Iran’s economic system meant that the IRI was dependent on forieg powers, regardless of the evidence to the contrary…”
Maziar Behrooz, 2000, I.B. Tauris; second edition, ‘Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran,’ pp.137-138 ↩︎